Vom Starkregen zur Bauwende: Impulse aus dem ExtremWetterKongress 2025
Mit dem ExtremWetterKongress 2025 wird ein dringend notwendiger Diskurs wieder in den Fokus gerückt: Wie reagieren Architektinnen, Planer und Bauakteure auf die quantitative und qualitative Zunahme extremer Wetterereignisse? Das Faktenpapier zum EtremWetterKongress 2025 liefert eindrückliche Daten – von steigender Häufigkeit von Starkregen, Hitzespitzen und Starkwindereignissen bis zu Schäden an Infrastruktur und Gebäuden.
Die 5 wichtigsten Erkenntnisse des ExtremWetterKongress 2025:
🌡️ Deutschland erwärmt sich doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt: Seit 1881 stieg die mittlere Temperatur hierzulande um +2,5 °C, weltweit im Schnitt nur um etwa +1,2 bis +1,3 °C
🔥 Zunahme von Hitzeereignissen: Heiße Tage (≥ 30 °C) haben sich seit den 1950er-Jahren vervierfacht – von etwa 3 auf 12 Tage pro Jahr im Mittel. Extreme Hitzewellen treten inzwischen regelmäßig auf
🏙️ Städte als Wärmeinseln: Verdichtete Bauweisen und fehlende Grünflächen führen zu teils erheblich höheren Nachttemperaturen in Städten, was die gesundheitliche Belastung bei Hitzewellen verstärkt
💧 Stärkere Extreme bei Niederschlag: Deutschland erlebt sowohl Rekordnässe (2023/24 war der niederschlagsreichste 12-Monats-Zeitraum seit Messbeginn) als auch extreme Trockenphasen (Februar–Mai 2025: trockenster Frühjahrszeitraum seit 1881)
🌲 Wachsende Waldbrandgefahr: Im Schnitt gab es 1961–1990 etwa 5 Tage pro Jahr mit hoher Brandgefahr. Heute sind es rund 10 Tage – 2025 sogar 16 Tage bis Ende August
Weitere Themen aus dem Faktenpapier: "Anstieg der Meeresspiegel", "Höhere Sturmfluten", "Häufigkeit mariner Hitzewellen in Nord- und Ostsee", "Auswirkung längerer Trockenperioden für Landwirtschaft und Wasserversorgung", ...
Klimarisiken versus baulicher Handlungsmacht
Vor dem Hintergrund des Kongresses müssen wir die Verbindung von Klimarisiken und baulicher Handlungsmacht dringend in der Branche besprechen: Welche Vorsorgemaßnahmen sind gebäude- oder städtebaulich wirksam? Wie lassen sich Widerstandsfähigkeit und Resilienz – angefangen von Grundrissgestaltung über Materialwahl bis zu Gründächern & Versickerungsstrategien – mehr ins Zentrum von Planung setzen? Und: Wie kann das Baurecht so gestaltet werden, dass es Klimaanpassung nicht ausbremst, sondern ermöglicht?
Ein zentrales Motiv des Kongresses ist es, Verantwortung zu verschieben: Nicht länger nur „da draußen“ über Klimaphänomene reden, sondern handeln. Für die Baubranche heißt das: Jede gebaute Anlage (Neubau, Sanierung, Infrastruktur) ist Schnittstelle und Stellhebel zugleich – um Risiken zu mindern und das Zusammenspiel von Bau und Klima neu zu gestalten.

Brücke: Die Baubranche im Klimaschutz
Warum liegt gerade in Ihrer Branche einer der größten Hebel? Kaum ein Sektor beeinflusst den globalen Ausstoß von Treibhausgasen so stark wie das Bauen. Nach Angaben des UN-Umweltprogramms entfallen auf Gebäude und Bauaktivitäten etwa ein Drittel der weltweiten CO₂-Emissionen sowie rund 32 % des Energieverbrauchs. Vor allem die Herstellung energieintensiver Baustoffe wie Zement oder Stahl schlägt dabei massiv zu Buche – sie allein verantworten fast 20 % der globalen Emissionen.
Diese Zahlen machen deutlich: Die Branche ist nicht nur Teil des Problems, sondern auch zentraler Teil der Lösung. Durch energieeffiziente Gebäude, ressourcenschonende Materialien und konsequente Kreislaufstrategien lässt sich der Fußabdruck des Bauens erheblich reduzieren – und der Weg in Richtung Klimaneutralität aktiv gestalten.
Unterhaken statt Hidden Agenda. Anpacken statt Abwarten. Chancen statt Risiken.
Der Kongress betont, dass dies nicht allein Technik- oder Ingenieurfragen sind, sondern zunehmend eine interdisziplinäre Aufgabe: Meteorolog:innen, Hydrolog:innen, Landschaftsarchitekt:innen, Bauingenieur:innen und Architektur dürfen nicht nebeneinander agieren, sondern müssen gemeinsam denken. Und entscheidend: Die Politik (Regionalplanung, Bauleitplanung, Förderprogramme) muss flankieren und Anreize schaffen, damit klimafeste Baukonzepte kein Sonderfall bleiben.
Für Architektur- und Planungsbüros eröffnen sich daraus Chancen: Wer frühzeitig Kompetenzen in Resilienzdesign, klimabewusste Baustoffwahl oder Anpassungsstrategien aufbaut, wird zunehmend gefragt sein – gerade weil Risiken sich verschärfen und Bauwerke über ihre Nutzungsdauer hinaus tragfähig sein müssen.
Doch Motivieren allein reicht nicht
Der ExtremWetterKongress 2025 ruft auch zur Verpflichtung auf – eine Verpflichtung, Klima-Szenarien in Planungsprozesse einzubeziehen, kritische Pfade (z. B. Regenwassermanagement, thermischer Komfort, Materialalterung unter Extrembedingungen) konsequent zu stress-testen und resilientere Lösungen nicht als Zusatzlast, sondern integralen Bestandteil guter Planung zu verstehen.
Damit wird klar!
Wer als Architekt:in oder Planer:in auf Klimaschutz setzt, greift nicht nur in Fragestellungen der Anpassung ein (Sturm, Starkregen, Hitze) – er oder sie ist zugleich Mitgestalt:in eines emissionsärmeren Bauens. Der ExtremWetterKongress 2025 kann daher als Weckruf dienen: Die Zeit für gehandelte Klimaverantwortung in der Baubranche ist jetzt. Und die Werkzeuge für die Planung nachhaltiger Architektur sind längst da.
Mit cockpit.planner gelingt die planungsbegleitende Ökobilanzierung und Betrachtung der Kreislauffähigkeit eines Gebäudeentwurfs ab Projektstart - direkt in der CAD, einfach per Klick, wissenschaftlich fundiert.

--------------------------------------
Download Faktenpapier: Was wir über Extremwetter in Deutschland wissen, Deutscher Wetterdienst, pdf.
Keywords: Klimawandel, Bauwende, Green Planning, LCA, Ökobilanz, Cradle to Cradle
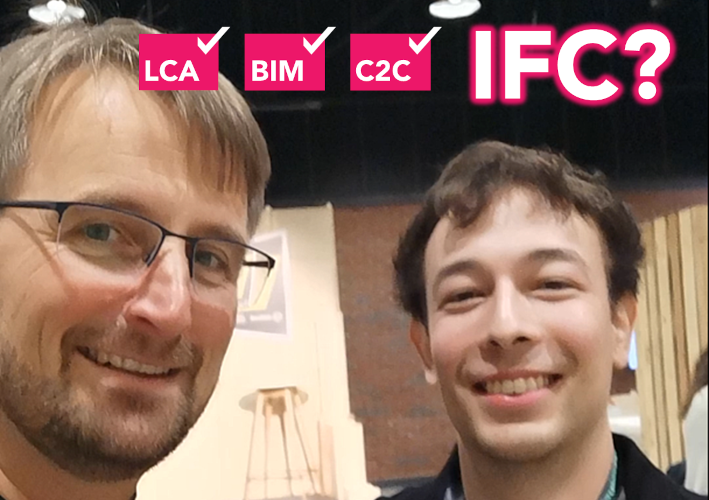








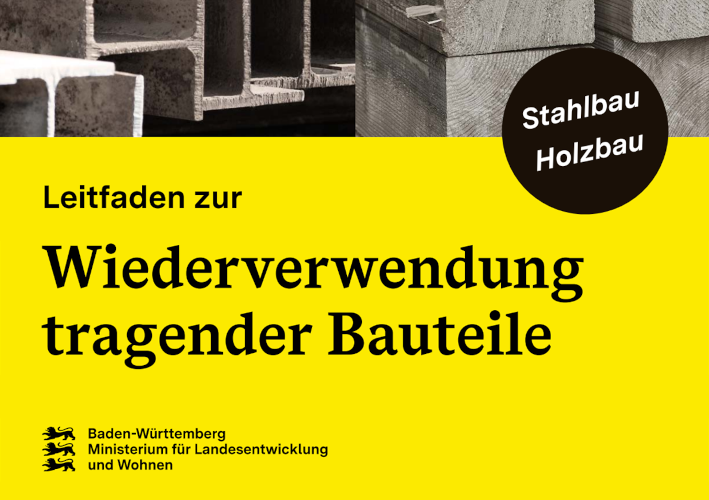
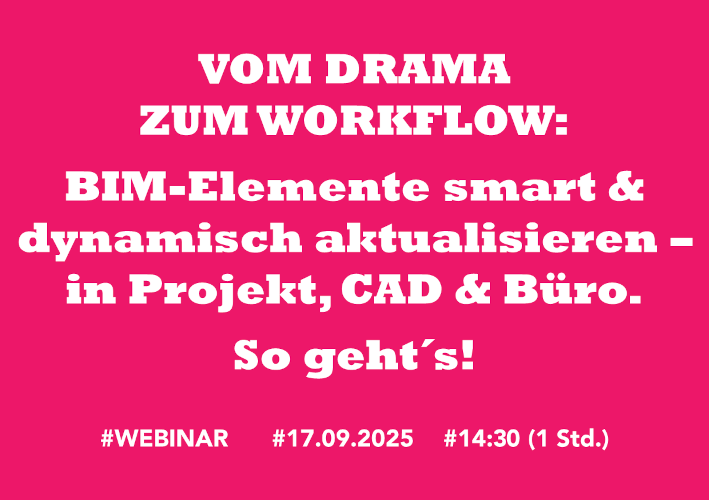

.png?width=673&height=152&name=image(10).png)